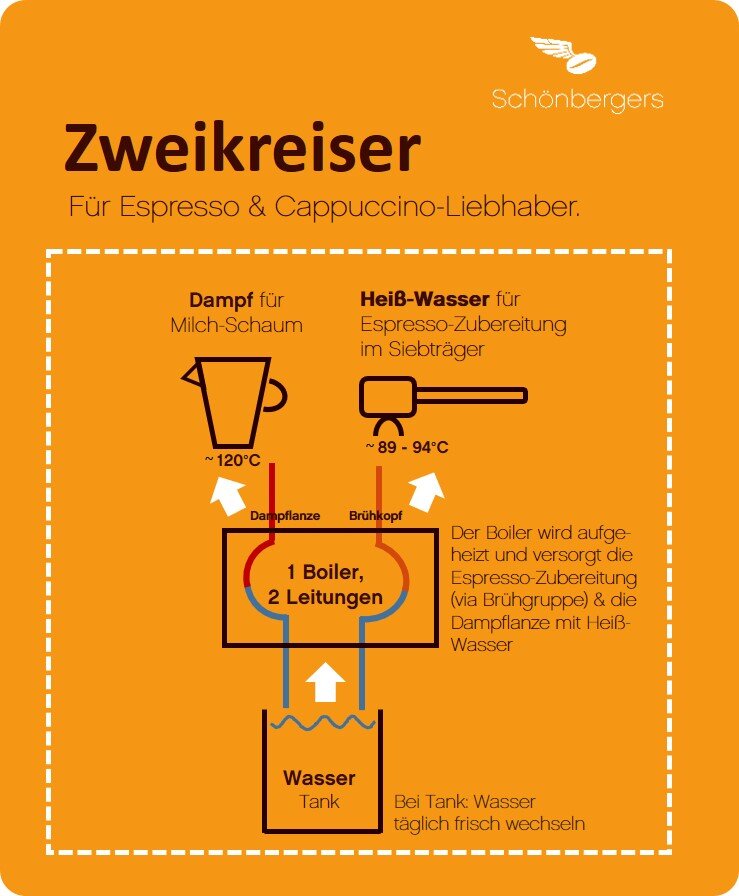"Schokoladiger" Kaffee - was ist das?
Als "schokoladig" bezeichnet man Kaffee, der dunkel geröstet ist. Wie dunkel, hängt dabei von der jeweiligen Region ab. Als generelle Grundregel kann man sich merken: in nördlichen Regionen wird traditionell eher heller, in südlicheren Regionen eher länger und somit dunkler geröstet. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel 😉.
Am Beispiel von Italien sieht das wie folgt aus: Die typische Triester Röstung ist heller als die traditionelle Röstung aus Neapel. Die wiederum ist meist etwas heller als die aus Rom. Am dunkelsten trinken dann die Sizilianer ihren Espresso. Sie haben ihn gern "ölig". Das sind die Öle des Kaffees, die bei der langen Röstung austreten - somit glänzen die Bohnen außen. Traditionell tranken auch Franzosen und Amerikaner ihren Kaffee gerne so - dort nennt man diese späte Röststufe "French Roast". Allerdings entwickelt sich auch dort ein Trend hin zu helleren, nordischen Röstungen.
Natürlich kann man diese "geografische Schubladen"-Denke nicht immer und überall anwenden, aber die Grundorientierung "je nördlicher, desto heller, je südlicher desto dunkler" gibt einen guten Anhaltspunkt, wie pro Region Kaffee traditionell getrunken wird.
Durch die vielen schönen Initiativen der “3rd Wave Coffee”-Brewers durchmischen sich diese traditionellen Ansätze mehr und mehr und bringen ein neues Kaffeebewusstsein nach Europa und damit auch nach Österreich.
Das Röstverfahren
Traditionell dauert ein Trommelröstvorgang zwischen 9 (für "sehr hell") bei rund 200°-218°C bis zu 16 Minuten (für "schokoladig"). Für helle Kaffees - sogenannte "Nordischen Röstung"- wird der Röstvorgang bereits nach dem 1. Crack (Minute 9-10) abgebrochen. Das Ergebnis ist ein fruchtiger, gut säurebetonter und wenig bitterer Geschmack.
Das Bild der Kaffee-Pucks - des Kaffeemehls also, durch das das Wasser im Siebträger gelaufen ist - zeigt sehr schön den Unterschied zwischen hellen und dunklen Röstungen.
Schokoladige Röstungen belässt man bis maximal 15 Minuten in der Rösttrommel. Diese längere Röstzeit gibt den Bohnen Zeit, alle Aromen auszubauen und ungewollte Säuren und Bitterstoffe abzubauen. Bei den "dunklen" Röstungen (bei Temperaturen von maximal 225°C) bilden sich Geschmacks-Nuancen von Schokolade und Nüssen. Oft wird diese Prägung dann mit "erdig" oder auch "ledrig" beschrieben.
Was bei der Röstung passiert, habe ich in folgendem Video zusammengefasst:
Das Aroma-Rad
Für die Wahl und Interpretation der Röstung gibt das "Geschmacksrad" Aufschluss:
Die linke Hälfte zeigt die vier Geschmacksqualitäten Süß, Sauer, Salzig und Bitter,
auf der rechten Hälfte sind die Aromen abgebildet, die mittels NASE wahrgenommen werden.
Belesene Coffee-Geeks wissen: Bei der Röstung entstehen über 800 Aromen. Die zeigt das Rad natürlich nicht - das würde sich platztechnisch nicht ausgehen ;) - sondern die Zusammenfassung der Kategorien.
Die "fruchtigen" Röstungen sind sehr interessant und hinterlassen am Gaumen oft unglaublich beeindruckende Nuancen von Zitronen, Mandarinen oder Erdbeeren (im Geschmacksrad oben rechts in gelb/apricot-Farben angezeigt).
Die dunkleren Röstungen, so wie man sie aus Italien kennt, sind im Geschmacksrad in Brauntönen gehalten (siehe Grafik, Mitte rechts): Die Bandbreite reicht hier von Nougat bzw. Milch-Schokolade (dunkel bis Milch) und Vanille über Nüsse (Hasel-, Pekanüsse, etc.) hin zu Malz und Bitterschokoladen-Charaktere.
Welche Bohne für welche Röstung?
Grundsätzlich können natürlich alle Kaffeebohnen - egal ob Single Origin oder Blends (Mischung aus verschiedenen Bohnen) - fruchtig (hell) oder schokoladig (dunkel) geröstet werden.
Der Trend geht allerdings aktuell in folgende Richtung:
Single Origins und 100%ige Arabica-Blends werden eher hell geröstet. Blends, die Robusta enthalten, eher dunkler. Das liegt auch daran, weil (gute) Robusta-Bohnen bei längerer Röstung ihren sensationell vollen, erdig-medizinischen Geschmack erst durch den Säure-Abbau der längeren Röstdauer voll zur Geltung bringen.
Ein Wort noch zur Qualität:
Der Geschmack von Single Origin Kaffees und Blends mag unterschiedlich sein, muss sich qualitativ aber nicht unterscheiden!
Wie erkennt man gute Kaffeequalität? Es mag banal klingen, aber die einfachste Grundlegel, die immer hilft ist: schaut auf den Preis!
Ich finde es jedenfalls bei jeder Tasse Kaffee aufs Neue spannend, die einzelnen Geschmacksnuancen herauszuschmecken - egal ob Estate Coffee oder hochwertiger Blend.
So oder so: lasst sie euch schmecken, die schönen schokoladigen Röstungen!
Euer Kaffeeliebhaber Patrick Schönberger, Euer "Kaffeegreissler”
PS: Lasst mich folgenden Nachsatz sagen: Billiger Kaffee ist, wie schon öfters festgehalten,
a) meist aus einer wesentlich schlechteren Rohbohnenqualität (teilweise zerbrochene Bohnen, enthält unreife Kirschen etc.),
b) meist als Industrieröstung aufbereitet und
c) kann versteckt Robusta-Bohnen sehr niederer Qualität als “Füllmaterial” enthalten. Denn im Großhandel gilt nach wie vor weltweit die unausgesprochene Regel: 2-5% einer Kaffeepackung können aus niederer Qualität bestehen. Ganz gemäß dem Motto: “Otto-Normalverbraucher wird es nicht schmecken.” Spüren wird er es vielleicht in Form von Magenschmerzen …
Verwandte Links & Tipps: